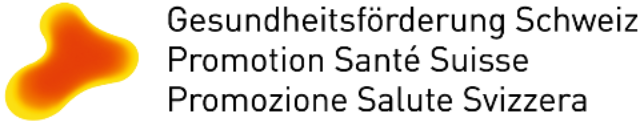Suzanne Lischer ist Professorin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Im Auftrag von Gesundheitsförderung Schweiz begleitete sie von 2021 bis 2024 als Evaluatorin die Umsetzung des Projekts «Gesundheitskompetenz dank selbsthilfefreundlicher Spitäler». An der Fachveranstaltung vom 27. August 2025 präsentiert sie mit ihrem Team diese Forschungsergebnisse.
Ab April 2025 vertieft sie ihre wissenschaftliche Arbeit zum Thema Selbsthilfe im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Forschungsprojekts «Zugangswege zu Selbsthilfegruppen», das bis März 2027 dauert.


Aktueller Forschungsstand zeigt: Selbsthilfe wirkt
Interview mit Prof. Suzanne Lischer, Hochschule Luzern
5. August 2025
Was hat ursprünglich dein Interesse geweckt, ein Projekt an der Schnittstelle von Gesundheitswesen und Selbsthilfe als Evaluatorin zu erforschen?
Als Sozialwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt gesundheitsbezogene Soziale Arbeit interessiere ich mich besonders für die Schnittstelle zwischen Gesundheit und dem Sozialen. Als die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz mit der Anfrage an die Hochschule Luzern herantrat, das Projekt zu evaluieren, habe ich keine Sekunde gezögert und umgehend unser Interesse bekundet, dieses Vorhaben umzusetzen.
Was waren für dich als Sozialwissenschafterin die spannendsten Neuerkenntnisse zur Selbsthilfe während der Evaluationsforschung?
Eine der spannendsten Erkenntnisse war für mich, wie stark die systematische Einbindung der Mitglieder von Selbsthilfegruppen und der Fachpersonen der Selbsthilfezentren in spitalinterne Prozesse nicht nur die interprofessionelle Zusammenarbeit fördert, sondern auch die Haltung medizinischer Fachpersonen nachhaltig beeinflusst. Besonders eindrücklich war zu beobachten, wie durch die aktive Beteiligung von Selbsthilfegruppen, etwa in Qualitätszirkeln, ein echter, wechselseitiger Wissensaustausch entsteht.
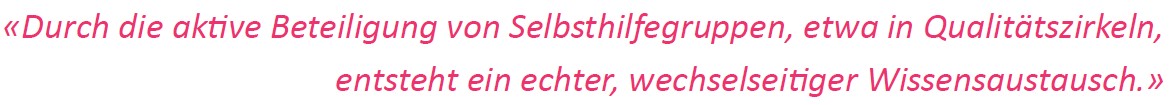
Dabei verändern sich Perspektiven auf beiden Seiten: Fachpersonen öffnen sich stärker für das alltagsnahe Erfahrungswissen, während Betroffene und Angehörige Einblick in klinische Abläufe gewinnen und sich ernst genommen sowie aktiv einbezogen fühlen. Diese Erfahrung hat mir deutlich vor Augen geführt, wie zentral Selbsthilfe für eine patient:innenzentrierte und integrierte Versorgung ist.
Wie beurteilst du generell den aktuellen Forschungsstand zur Selbsthilfe?
Der Forschungsstand zum Thema Selbsthilfe ist mittlerweile beachtlich. Insbesondere zu ihren Wirkungen liegt eine Vielzahl an Studien vor. Im DACH-Raum wurde zudem intensiv zum Thema Selbsthilfefreundlichkeit im Gesundheitswesen geforscht. Von diesen Erkenntnissen konnten wir in unserem Projekt stark profitieren.
Worin bestehen die Herausforderungen, wenn man Selbsthilfe erforscht, und wie könnt ihr Forschenden damit umgehen?
Die Erforschung von Selbsthilfe ist mit mehreren Herausforderungen verbunden. Zum einen erschwert die methodische Heterogenität die Vergleichbarkeit der Studien, zumal auch die Themen und Formen von Selbsthilfegruppen stark variieren. Die Gruppenkonstellationen unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich Alter, Krankheitsbildern oder Organisationsgrad. Viele Studien sind qualitativ ausgerichtet. Das ermöglicht zwar tiefe Einblicke in individuelle Erfahrungen, erschwert jedoch systematische Vergleiche zwischen Gruppen oder Themenfeldern.
Hinzu kommt eine gewisse Selektivität: Personen, die an Selbsthilfegruppen teilnehmen, sind häufig sozial besser eingebunden oder gesundheitlich stabiler, was die Interpretation positiver Wirkungen verzerren kann.
Für uns Forschende ist es daher zentral, diese Einschränkungen offen zu benennen und die methodischen Limitationen transparent zu machen, um die Ergebnisse differenziert einordnen zu können.
In welchen Wissenschaften wird überhaupt zum Thema Selbsthilfe geforscht? Je nachdem werfen diese einen unterschiedlichen Blick auf die Selbsthilfe. Welche Erkenntnisse ergibt das im Vergleich?
Zum Thema Selbsthilfe wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen geforscht, wobei je nach Fragestellung unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden. In der Medizin und Psychotherapie steht häufig die Wirksamkeit von Selbsthilfegruppen im Hinblick auf Krankheitsverläufe oder das psychische Wohlbefinden im Vordergrund. Die Sozialwissenschaften und die Soziologie richten ihr Interesse eher auf die gesellschaftliche Funktion von Selbsthilfe, etwa als Ausdruck zivilgesellschaftlichen Engagements oder kollektiver Selbstorganisation. In der Sozialen Arbeit wiederum liegt der Fokus auf der Rolle der Selbsthilfe im Versorgungssystem sowie auf Fragen der Teilhabe, des Selbstmanagements, des Empowerments und der Inklusion.
Hand auf’s Herz: Die grosse Frage, die uns in der Selbsthilfeförderung schon lange umtreibt, ist natürlich: Gibt es Studien, die «beweisen», was die Selbsthilfegruppen und Profis, welche diese unterstützen, schon lange zu wissen glauben – nämlich, dass gemeinschaftliche Selbsthilfe positiv wirkt? Oder falls nicht – Warum nicht?
Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Studien, die die positiven Wirkungen gemeinschaftlicher Selbsthilfe belegen.
Selbsthilfe stärkt nachweislich die Gesundheitskompetenz von Betroffenen und Angehörigen. Darüber hinaus zeigen Studien positive Effekte auf das psychische Wohlbefinden und die soziale Teilhabe. Eine Review-Arbeit von Bjørg Aglen und Kolleg:innen aus Norwegen aus dem Jahr 2011, auf die ich mich gerne beziehe, identifiziert vier zentrale psychosoziale Wirkungsbereiche: die individuelle Bewältigungskompetenz, die zur besseren Alltagsbewältigung beiträgt, die soziale Dimension mit Fokus auf Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung sowie Prozesse des Empowerments, des Copings und des Kohärenzgefühls, die ein stärkeres Selbstmanagement und eine erfolgreiche Krankheitsbewältigung fördern. Schliesslich wird Selbsthilfe auch als komplementäres Versorgungsangebot verstanden, das psychosoziale Aspekte aufgreift, die in der medizinischen Versorgung oft zu kurz kommen. Auch wenn nicht alle Wirkungen in klassischen Studienformaten messbar sind, lässt sich sagen: Ja, Selbsthilfe wirkt, und das wird durch eine breite Studienlage gestützt.
Gleichzeitig gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die Wirksamkeit immer auch vom individuellen Kontext abhängt: Ob und wie Selbsthilfe wirkt, ist stark davon beeinflusst, welche Person oder Gruppe beteiligt ist.

Was hat dich dazu bewogen, ein weiteres Forschungsprojekt zur Selbsthilfe zu starten? Welche Überlegungen stehen hinter der Schwerpunktsetzung, den Zugang zur Selbsthilfe zu erforschen?
Bisher konzentriert sich die Forschung zu Selbsthilfegruppen vor allem auf ihre Wirksamkeit. Der Zugang zu diesen Gruppen gehört jedoch zu den bislang wenig erforschten Aspekten. Es fehlen empirische Erkenntnisse darüber, wie Menschen den Weg in eine Selbsthilfegruppe finden und wie der Übergang in eine aktive Mitgliedschaft gelingt.
Mit unserem Projekt wollen wir genau hier ansetzen: Wir möchten Zugangswege zur Selbsthilfe entlang des Gesundheitspfades aufzeigen, ungenutzte Potenziale sichtbar machen und darauf aufbauend konkrete Handlungsempfehlungen für eine patient:innenzentrierte Gesundheitsversorgung in der Schweiz entwickeln, die die Selbsthilfe systematisch einbezieht.
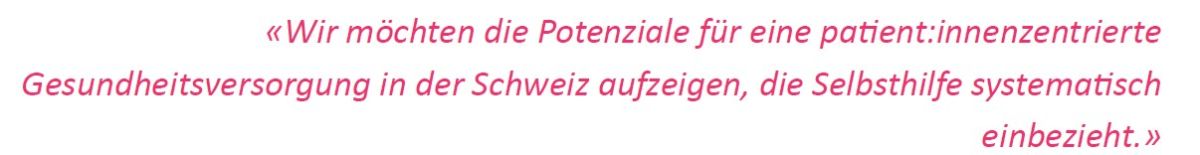
Wo steht ihr mit dem Forschungsprojekt, und was steht als nächstes an? Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?
Das Projekt gliedert sich in mehrere methodische Schritte zur Erhebung und Validierung unterschiedlicher Perspektiven. In der ersten Phase führen wir leitfadengestützte Interviews mit Mitgliedern von Selbsthilfegruppen, mit betroffenen Personen ohne Gruppenerfahrung, mit Fachpersonen aus Selbsthilfezentren, mit Vertretenden von Patientenschutzorganisationen sowie mit Mitarbeitenden aus dem medizinischen und psychosozialen Versorgungssystem.
Auf Basis der Auswertung dieser Interviews entwickeln wir einen standardisierten Fragebogen, der sich an Mitglieder von Selbsthilfegruppen und an medizinische Fachpersonen richtet. Abschliessend werden die Ergebnisse in Fokusgruppen qualitativ validiert. Aktuell befinden wir uns in der Interviewphase. Der Schlussbericht wird voraussichtlich Anfang 2027 veröffentlicht.
Ganz herzlichen Dank für das Interview!
Literaturverweis: Aglen, Bjørg et al. (2011): Self-Help and self-help groups for people with long-lastinghealth problems or mental health difficulties in a Nordic context : A review. Scandinavian Journal of Publi Health, 39 : 813-822
Kontakt zur Interviewpartnerin: www.hslu.ch, suzanne.lischer(at)hslu.ch
Das Interview wurde schriftlich durchgeführt durch Elena Konstantinidis, Selbsthilfe Schweiz